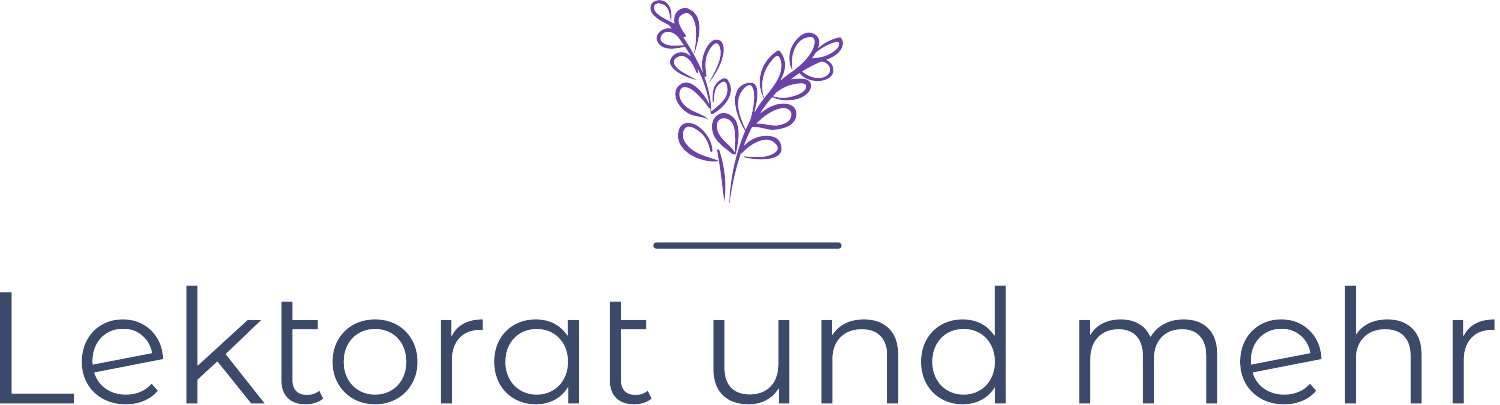Warum ich bei Gott nicht erwachsen sein muss
Eine Frauenkonferenz mit 150 Teilnehmerinnen - ein großes Ereignis! Es gibt Seminare, Workshops, Seelsorgeangebote. Ich bin gespannt und gleichzeitig in abwartender Haltung: Mal sehen, was auf mich zukommt ... Mit ein paar Freundinnen mische ich mich unter die vielen Frauen, höre interessante Referate, unterhalte mich mit alten Bekannten, freue mich an der liebevoll gestalteten Dekoration. Es ist ein schönes Wochenende, vielleicht nicht ganz so erfüllend, wie ich es mir gewünscht hätte, aber auf jeden Fall anregend und ermutigend.
„Unter all unsrer Stärke scheint ein tiefes Bedürfnis zu stecken, schwach sein zu dürfen.“
So denke ich - bis zum Abschlussgottesdienst. Die gemeinsamen Anbetungslieder, die leidenschaftliche Predigt, die bewegenden Zeugnisse nehmen mich mit hinein in die Begegnung mit Gott. Sie überwinden meine innere Distanz, und plötzlich kommt mir die Botschaft, dass Gott mein Vater sein will, ganz nahe. Es geht nicht mehr darum, wie ich das alles hier sehe, sondern darum, wie Gott mich sieht. Ich fühle mich in der Tiefe berührt und spüre, wie die Tränen in mir aufsteigen. Da ist so viel, was nach außen drängt, und es tut gut, es einfach zuzulassen.
Immer wenn Gott mich so berührt, wenn ich seine Gegenwart spüre, wenn ich seine Liebe nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen erfasse, muss ich weinen. Es ist, als würde etwas in mir aufbrechen, als würde eine Mauer fallen. Meine Emotionen dringen ungehindert nach außen, und es ist nicht der Jubel, der Überschwang, das große Glück. Nein, es sind die Tränen. In letzter Zeit gab es mehrere Momente, in denen ich das so erlebt habe, und es hat mich überrascht.
Ich bin Gottes geliebte Tochter. Wenn mir das ins Bewusstsein kommt, müsste ich eigentlich tanzen vor Freude. Aus Liebe zu mir hat Jesus sein Leben hergegeben. Ist das nicht ein Grund, laut zu singen? Woher kommen dann die Tränen? Ist es die unterdrückte Traurigkeit aus tausend Alltagssituationen - scheinbar gut bewältigt -, die in so einem Moment nach außen drängt?
Ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Andere Frauen haben mir von ähnlichen Erfahrungen berichtet.
Unter all unserer Stärke, der sozialen Kompetenz, die wir uns angeeignet haben, unserer Leistungsfähigkeit und Effektivität als Ehefrauen, Mütter und Mitarbeiterinnen in der Gemeinde, unserem Durchsetzungsvermögen in der beruflichen Welt, unserem selbstverständlichen Umgang mit neuen Medien - unter all dem, was wir nach außen und für andere darstellen - scheint ein tiefes und oft verborgenes Bedürfnis zu stecken, schwach sein zu dürfen, einfach nur sein zu dürfen.
In manchen Situationen ist es mir richtig bewusst, dass ich nicht einfach nur sein darf. Da spüre ich, wie sich kindliche Reaktionen in mir regen - ich möchte am liebsten weglaufen, laut aufheulen oder mit dem Fuß stampfen. Natürlich verhalte ich mich nicht so, ich bin ja erwachsen. Ich habe die Regeln der Kommunikation - wenigstens einigermaßen - gelernt: Ich darf Gefühle zum Ausdruck bringen, aber möglichst nur als Ich-Botschaft, ohne Anklage und in ruhigem Ton. Also reiße ich mich zusammen und versuche, diplomatisch und sachlich zu bleiben, wenn ich mit einer Sache überhaupt nicht einverstanden bin. Also wahre ich das Gesicht, wenn mich jemand durch sein Verhalten verletzt. Also behalte ich die Fassung, wenn ich mit unangenehmen Dingen konfrontiert werde.
Sich zusammenreißen, das Gesicht wahren, die Fassung behalten - da kommt schon durch die Sprache zum Ausdruck, dass meine spontanen Gefühle in ein Korsett gezwängt werden, in eine gesellschaftsfähige Form sozusagen. Ich halte es keineswegs für verkehrt, dass jeder Mensch sich ein Stück weit kontrolliert und nicht alles ungefiltert zum Ausdruck bringt, was gerade in ihm vorgeht. Ich stelle aber bei mir selber fest, dass diese Kontrolle so zu meiner zweiten Natur geworden ist, dass ich manchmal gar keinen richtigen Zugang mehr zu meinen Gefühlen habe.
Irgendwie ist mir die kindliche Unbeschwertheit verloren gegangen. Ich möchte eine starke Frau sein, ich bin eine starke Frau. Ich trage eine Menge Verantwortung - für mein eigenes Leben, für meine Kinder, für den Haushalt, meine berufliche Arbeit, für die Aufgaben, die ich in der Gemeinde übernommen habe. Meistens denke ich gar nicht darüber nach, sondern schultere diese Verantwortung ganz selbstverständlich. Sie gehört zu meinem Leben und ich wachse an ihr. Doch selbst wenn ich sie nicht als Last empfinde, glaube ich doch, dass sie mir einiges abverlangt und mich mehr Kraft kostet, als mir bewusst ist.
Einerseits ist da meine ganze Unzulänglichkeit und Schwachheit, meine Anfälligkeit, in bestimmten Situationen Fehler zu machen. Andererseits sind da meine Kinder, die von mir abhängen, die auf mich sehen und denen ich Gutes für ihr Leben mitgeben möchte. Oder die Menschen, die sich auf mich verlassen und mir vertrauen, beruflich wie privat. Ich habe nicht den Anspruch, alle Erwartungen zu erfüllen, die an mich gestellt werden - wer könnte das schon? Aber ich möchte, soweit möglich, doch die jeweilige Rolle gut ausfüllen, die mir in verschiedenen Lebensbereichen vorgegeben ist.
Mir wird bewusst, dass das etwas nach "funktionieren" klingt, und das hat einen negativen Beigeschmack. Maschinen funktionieren. Aber Menschen wollen mehr als das. Sie wollen leben! Ich will leben! Und trotzdem - ich bin Teil einer Gemeinschaft und das bedeutet, es geht nicht nur um mich und meine Bedürfnisse. Das Leben mit den Menschen um mich her kann nur gelingen, wenn es aus Geben und Nehmen besteht, aus Verzichten und Beschenkt-Werden.
Das bringt mich dahin zurück, dass ich einen bestimmten Platz ausfülle, individuell natürlich, ohne mich selbst aufzugeben, aber doch in dem Bemühen, den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden.
Das ist so der Alltag, der mir mal mehr, mal weniger Freude macht. Und dann spricht Gott mir zu, dass er keine Anforderungen an mich hat. Dass ich bei ihm keine Rolle ausfüllen muss. Dass er alles in der Hand hat und ich keine Verantwortung trage. Dass ich nicht zu funktionieren brauche. Dass ich nicht erwachsen und reif sein muss, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ganz im Gegenteil, die Sehnsucht danach, Kind sein zu dürfen, hat er selbst in mich hineingelegt. Er möchte mein Vater sein.
Ich lese und höre oft, was Gott für mich sein will. Meiner Persönlichkeit nach bin ich ein sachlicher Typ, der vieles vom Verstand her angeht, und oft leide ich darunter, dass sich mein Glaube zum großen Teil im Kopf abspielt, so unemotional ist. Aber in seltenen und darum umso kostbareren Momenten wird Gottes Liebe für mich greifbar und real. Plötzlich spüre ich, dass ich bei ihm alles loslassen darf. Ich muss mich nicht anstrengen, nicht verkrampfen, nichts darstellen und nichts im Griff behalten. Ich darf einfach nur sein.
Das berührt mich auf einer ganz tiefen Ebene, dort wo die unterdrückten Gefühle sitzen, alte Verletzungen, die nie richtig verheilt sind, unstillbare Sehnsüchte, der Hoffnungslosigkeit anheim gegebene Wünsche, die Verzweiflung über die eigene Unfähigkeit, die zu sein, die ich gern wäre, das Gefühl der Überforderung, das Leiden an der Ungeborgenheit in einer Welt, die ständig ihre Opfer fordert, die Trauer über die Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe ... Gott legt seine Hand genau auf diese wunden Punkte. Und ich spüre: Er kennt meinen Schmerz.
Das zu erfahren löst auf befreiende Weise meine ganze Anspannung und die ungeweinten Tränen dringen nach außen. Wenn mir das passiert, dass ich so weine, dann hat das wirklich etwas damit zu tun, dass ich die "Fassung" verliere, nicht mehr das starke Gesicht nach außen zeige. In mir fühlt sich alles weich und schwach und verletzlich an, es ist ein direkter Zugang zu meinen Gefühlen da und zu meinem tiefen Inneren, anders als sonst.
Ich muss da an das Märchen vom Froschkönig denken: Nach seiner glücklichen Entzauberung fährt der Königssohn zusammen mit seiner Braut in sein Reich. Der treue Heinrich, sein Diener, steht hinten auf der Kutsche. Drei Mal krachte es laut, und jedes Mal ruft der Königssohn: "Heinrich, der Wagen bricht." Der Diener antwortet jedoch: "Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als Ihr in dem Brunnen gelegen." - Viele Jahre hat er sich beherrscht, hat funktioniert und seinen Schmerz vergraben, aber jetzt, wo alles wieder gut ist, sprengt es die Bande von seinem Herzen. Er braucht sie nicht mehr, er kann wieder frei atmen.
So geht es mir, wenn mir Gott als Vater greifbar wird. Bei mir kracht es nicht, sondern es fließen die Tränen. Aber der Grund ist ähnlich - die Bande um mein Herz werden gesprengt, weil ich spüre, dass hier bei Gott alles wieder gut wird.
„Gott, der mütterlich und väterlich zugleich ist, möchte die Ursehnsucht in mir stillen.“
Dass Gott mich zu seinem Kind macht, habe ich lang als eine Art Adoption verstanden: Mein erwachsenes Ich hat nicht nur leibliche Eltern, sondern auch einen göttlichen Vater. Jetzt sehe ich eine weitere Dimension der Kindschaft - es geht nicht nur darum, dass ich zu Gottes Familie gehöre, sondern auch darum, dass ich hier schwach und Kind sein darf, während ich überall sonst stark und erwachsen bin. Dazu passt die Einladung, die Jesus mehrmals ausgesprochen hat, so zu werden wie die Kinder.
In Fritz Riemanns Buch "Grundformen der Angst" wird ausführlich geschildert, wie sehr unsere Persönlichkeit und unser Leben von Kindheitserfahrungen geprägt werden. Der Autor beschreibt die tiefe Bindung, die anfänglich zwischen Kind und Mutter besteht: "Es (das Kind) ist ganz auf sie (die Mutter) angewiesen und auf sie ausgerichtet, sie ist sein wichtigster Bezugspunkt. Das Kind nimmt ihr Bild und ihr Wesen mit allen Sinnen in sich auf. Durch die lange Dauer seiner totalen Abhängigkeit von der Mutter prägt sich ihr Bild tief in seine Seele ein. So wird die Mutter 'ver-innerlicht’, wird zu einem ungemein wichtigen Seelenbestandteil des Kindes" (Fritz Riemann: Grundformen der Angst. Ernst Reinhard Verlag, 1997. S. 75).
Mutter und Kind sind beinah untrennbar miteinander verbunden und das Kind hat grenzenloses Vertrauen in die Mutter. In ihren Armen fühlt es sich völlig geborgen. Ich glaube, es ist eine Ursehnsucht des Menschen, in diese Geborgenheit zurückzufinden. So richtig deutlich ist mir das geworden, als ich vor längerer Zeit einen Film über eine Frau sah, die ihre alte Mutter pflegte. In einem bewegenden Moment, als die alte Frau schon gar nicht mehr klar erfasste, was um sie herum geschah, spürte sie, dass jemand bei ihr war und sagte fragend: "Mutter?" - In einer Situation, in der sie ganz schwach war, wurde sie wieder zum Kind, das die Hand nach der Mutter ausstreckt.
Gott, der mütterlich und väterlich zugleich ist, möchte diese Ursehnsucht in mir stillen. Ich bin dankbar über die Momente, in denen ich ihn als Zuflucht erfahren darf. Dann weine ich und sage mit David: "Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir." (Psalm 131,2)